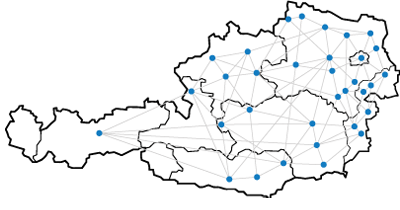Erhöhung des Investitionsfreibetrags ab 1.11.2025 geplant – Investitionen klug planen, Günstigkeitsvergleich zwischen IFB und Gewinnfreibetrag anstellen!
Stand: 8. Oktober 2025
Anfang September 2025 wurde von der österreichischen Bundesregierung ein Maßnahmenpaket zur Stärkung der heimischen Wirtschaft vorgestellt, das insbesondere die zeitlich befristete Verdoppelung des Investitionsfreibetrags (IFB) von 10% auf 20% (für Öko-Investments von 15 % auf 22 %) zwischen 1. November 2025 und 31. Dezember 2026 vorsieht. Die konkrete Gesetzwerdung bleibt zwar noch abzuwarten, aufgrund des vorliegenden parlamentarischen Initiativantrags vom 24.9.2025 liegen die Eckpunkte für die geplanten Änderungen jedoch bereits im Entwurf vor. Auf Basis dieser Informationen soll nachstehend für Unternehmer:innen, die den Gewinnfreibetrag in Anspruch nehmen können, überprüft werden, inwieweit es für im Jahr 2025 geplante Investitionen steuerlich günstiger ist, den erhöhten IFB oder den investitionsbedingten Gewinnfreibetrag geltend zu machen und diese Wirtschaftsgüter dementsprechend zu widmen. Planen Sie die zeitliche Anschaffung bzw. Inbetriebnahme jedenfalls klug!
Hintergrund dieses Günstigkeitsvergleichs ist die Tatsache, dass natürliche Personen bzw. Personengesellschaften, soweit daran natürliche Personen beteiligt sind, zwar grundsätzlich den IFB und den (investitionsbedingten) Gewinnfreibetrag (GFB) nach eigener Wahl kombinieren, die beiden Instrumente allerdings nicht gleichzeitig für dasselbe begünstigte Wirtschaftsgut in Anspruch genommen werden können.
Der IFB als zusätzliche steuerliche Betriebsausgabe kann nur für ungebrauchte Wirtschaftsgüter des abnutzbaren Anlagevermögens geltend gemacht werden, die eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von mindestens vier Jahren haben und einem inländischen Betrieb oder einer inländischen Betriebsstätte zuzurechnen sind. Er kann pro Betrieb höchstens von Anschaffungs- oder Herstellungskosten in Höhe von EUR 1.000.000 im Wirtschaftsjahr beantragt werden, wobei die jeweilige Abschreibungsbasis für die AfA durch den IFB nicht gekürzt wird. Zu beachten ist, dass die tatsächliche Steuerersparnis durch den IFB vom jeweils anzuwendenden, progressiven Einkommensteuersatz (bis zu 55%) abhängig ist.
Ein geltend gemachter IFB ist nachzuversteuern, wenn das begünstigte Wirtschaftsgut innerhalb von 4 Jahren (taggenaue Berechnung) aus dem Betriebsvermögen ausscheidet (ausgenommen bei höherer Gewalt oder durch behördlichen Eingriff) oder ins Ausland verbracht wird (ausgenommen die entgeltliche Überlassung zur Nutzung in einem EU-/EWR-Staat).
Der IFB beträgt aktuell 10% der Anschaffungs- oder Herstellungskosten, für Wirtschaftsgüter, die dem Bereich Ökologisierung zuzuordnen sind, 15%. Laut dem vorliegenden Initiativantrag sind diesbezüglich nun folgende Änderungen geplant:
Soweit Anschaffungs- oder Herstellungskosten nachweislich auf den Zeitraum nach dem 31. Oktober 2025 und vor dem 1. Jänner 2027 entfallen, beträgt der Investitionsfreibetrag
- 20 % der begünstigten Anschaffungs- oder Herstellungskosten und
- 22 % der begünstigten Anschaffungs- oder Herstellungskosten bei Wirtschaftsgütern, deren Anschaffung oder Herstellung dem Bereich Ökologisierung zuzuordnen ist.
Wird die Anschaffung oder Herstellung erst nach dem 31. Dezember 2026 beendet, steht die Erhöhung nur zu, wenn der Investitionsfreibetrag für die im begünstigten Zeitraum aktivierten Teilbeträge geltend gemacht wird.
Vom Investitionsfreibetrag ausgenommen sind insbesondere Gebäude, geringwertige Wirtschaftsgüter, gebrauchte Wirtschaftsgüter, Anlagen zur Förderung oder Nutzung fossiler Energieträger, bestimmte unkörperliche Wirtschaftsgüter, aber eben auch Wirtschaftsgüter zur Deckung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrages.
Aufgrund dieses gegenseitigen Ausschlusses zwischen IFB und Gewinnfreibetrag hinsichtlich der „Widmung“ von angeschafften Wirtschaftsgütern stellt sich für den Unternehmer die Frage, welche steuerliche Begünstigung er in Anspruch nehmen soll. Diese Abwägung ist jedoch nur für natürliche Personen bzw. Personengesellschaften, soweit daran natürliche Personen beteiligt sind, relevant, da nur diese den Gewinnfreibetrag steuerlich ansetzen können. Für Kapitalgesellschaften stellt sich diese Frage daher nicht, für sie ist der Ansatz des IFB jedenfalls vorteilhaft.
Für die Entscheidung, ob ein Wirtschaftsgut dem IFB oder dem investitionsbedingten Gewinnfreibetrag gewidmet werden soll, können folgende Ausführungen hilfreich sein:
- Liegt der steuerliche Gewinn unter EUR 33.000, ist es stets vorteilhafter, den IFB zu beantragen, da der investitionsbedingte Gewinnfreibetrag erst bei einem Gewinn über dieser Schwelle möglich ist. Die erworbenen Wirtschaftsgüter können daher jedenfalls dem IFB zugeordnet werden. Zusätzlich kann der Grundfreibetrag in Höhe von 15% des Gewinns (in Höhe von maximal EUR 33.000) angesetzt werden.
- Im Falle von Verlusten kann der IFB die Steuerbemessungsgrundlage negativ werden lassen bzw. einen bestehenden Verlust vergrößern. Ein entsprechender Verlustausgleich oder Verlustvortrag ist möglich. Ein Gewinnfreibetrag ist in Verlustjahren bezeichnenderweise ausgeschlossen.
- Bei größeren Investitionen ist zu beachten, dass der investitionsbedingte Gewinnfreibetrag betraglich mit maximal EUR 41.450 jährlich gedeckelt ist.
- Der IFB ist daher im Vergleich dann günstiger, wenn – nach aktuell noch geltender Rechtslage – in Wirtschaftsgüter investiert wird, deren Anschaffungs-/Herstellungskosten mehr als EUR 414.500 betragen (Steuerersparnis > EUR 41.450); im Fall des 15%-igen IFB für Öko-Investments beträgt dieser Schwellenwert nur mehr EUR 276.333.
- Wird der IFB nun auf 20% bzw. 22% erhöht, sinkt der Schwellenwert weiter, nämlich auf EUR 207.250 bzw. EUR 188.409.
Um das optimale steuerliche Ergebnis zu erzielen, ist bei natürlichen Personen bzw. bei Personengesellschaften, soweit daran natürliche Personen beteiligt sind, jedenfalls eine entsprechende Investitions- und Ergebnisplanung sowie die Erstellung einer zeitgerechten Vorschaurechnung zu empfehlen. Dabei sind auch mehrjährige Investitionen und Verlustsituationen zu berücksichtigen.
Stand: 8. Oktober 2025 | LBG
Kontakt & Beratung: Diese Information zeigt naturgemäß grundlegende Aspekte des Themas auf – für Vollständigkeit und Richtigkeit kann trotz sorgfältiger Erstellung keine Gewähr geleistet werden. LBG berät Sie gerne in Ihrer individuellen Situation. Bitte wenden Sie sich an einen unserer 35 österreichweiten Standorte (www.lbg.at). Erstkontakt gerne auch an welcome@lbg.at - wir bringen Sie mit einem/r unserer Experten/innen, der/die mit Ihrem Anliegen bestens vertraut ist, zusammen.
LBG - Steuern, Bilanz, Buchhaltung, Personalverrechnung, Gutachten, Prüfung, Betriebswirtschaft, Digital Services, Unternehmensführung.
© LBG Österreich: Wenn Sie Interesse daran haben, den Inhalt dieser LBG-Fachinformation einer begrenzten oder breiteren Öffentlichkeit in eigenen Publikationen im Unternehmen, von Unternehmensverbänden oder Vereinen, in Newslettern, auf einer Homepage oder in Online-Medien oder als Redakteur/Journalist eines Branchen-, Fach- oder Publikumsmediums auch durch uns zusammengefasst, weiter vertieft oder durch einen unserer Expert/innen kommentiert zur Verfügung zu stellen, dann unterstützen wir Sie dabei gerne. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir Sie in diesem Fall um die geeignete Nennung von LBG Österreich ersuchen. Gerne beantworten wir Ihre Fragen und bitten Sie, Ihre Kontaktwünsche an welcome@lbg.at zu richten.